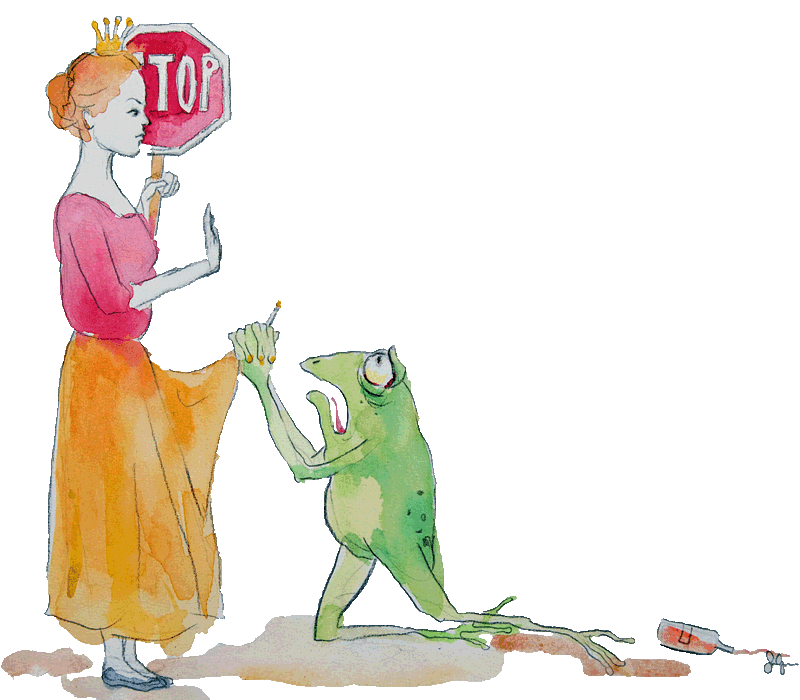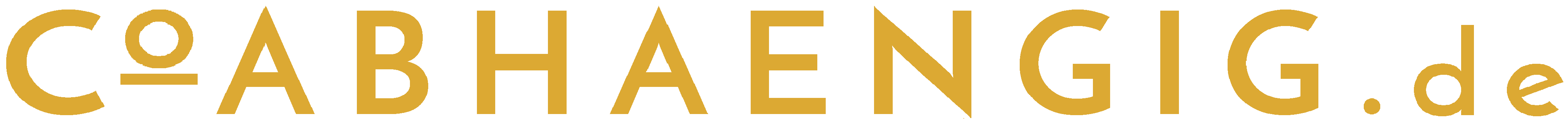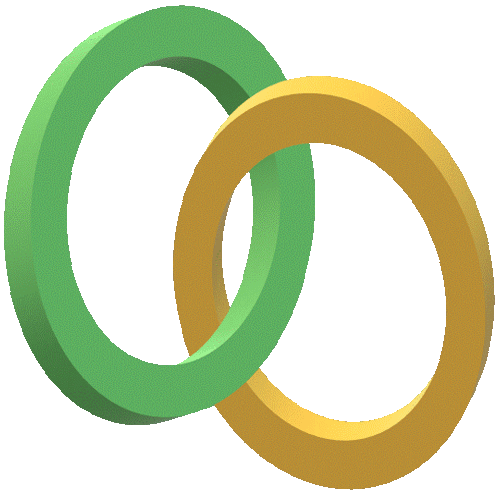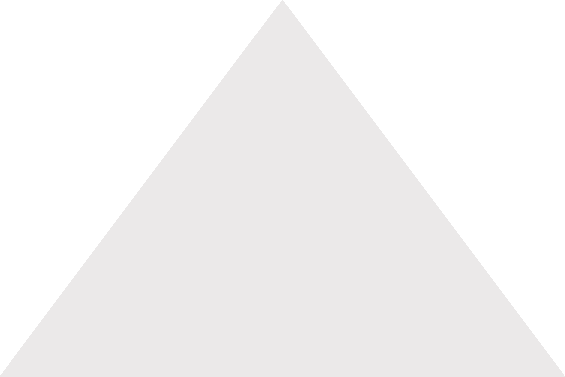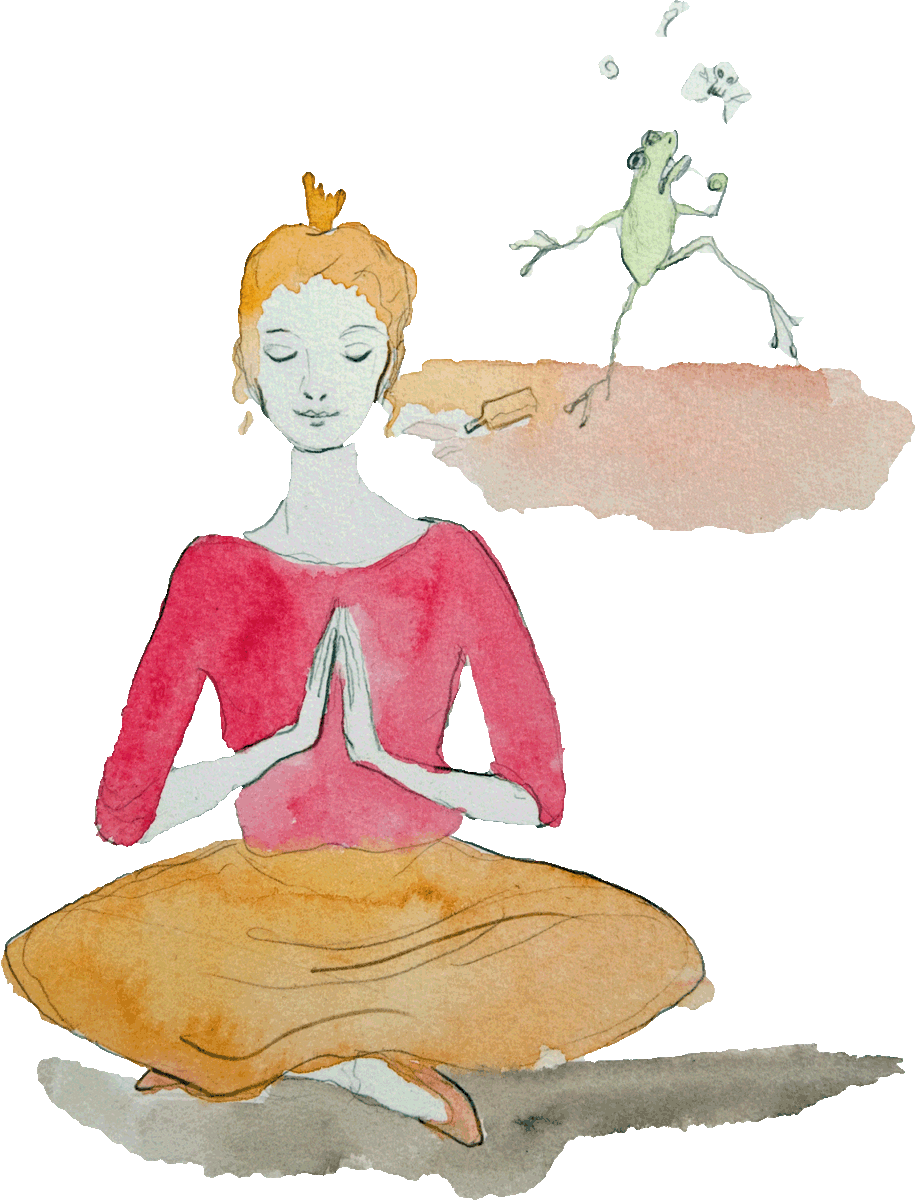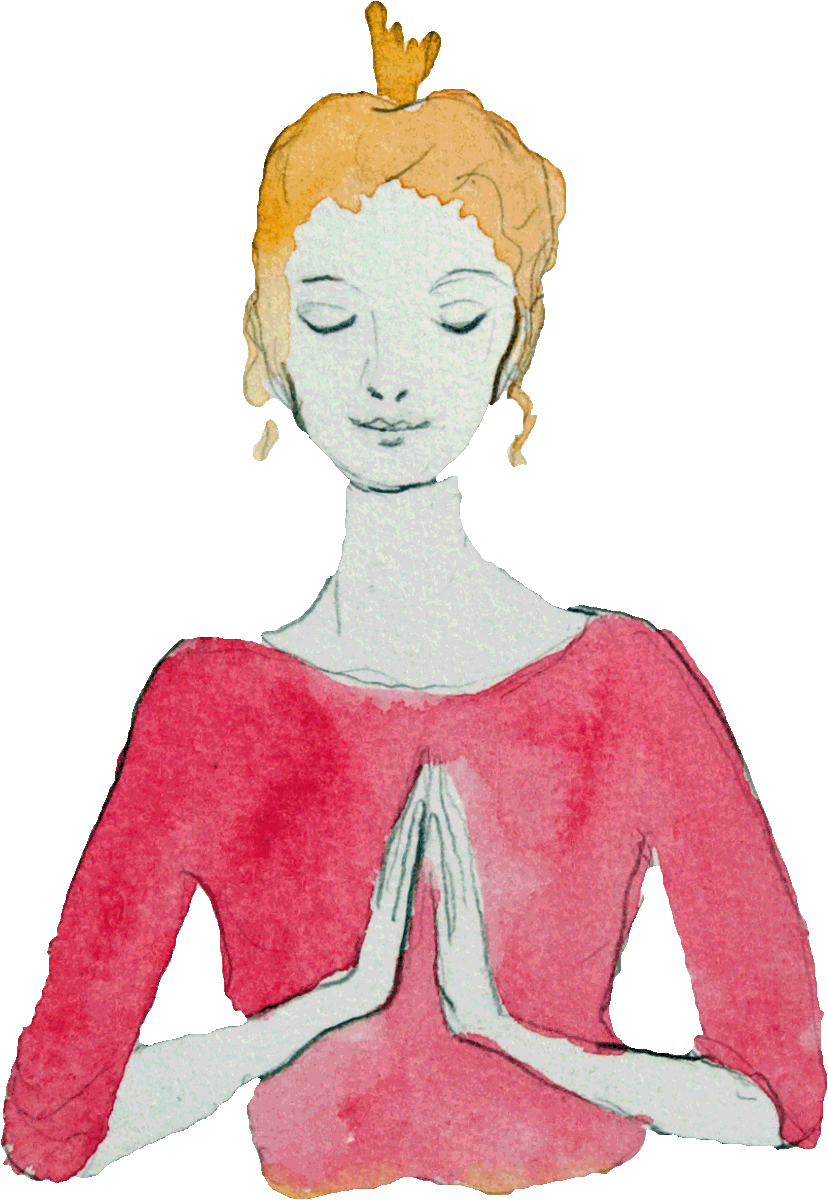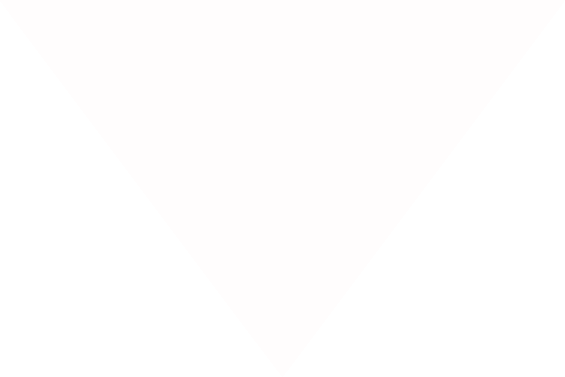Folgend einige Hinweise zum Gebrauch und zum konzeptionellen Hintergrund dieser Website:
Schmökern
Diese Website ist zum Schmökern gedacht. Sie ist gefüllt mit Informationen, die sich an verschiedene Gruppen richten: Kinder aus Suchtfamilien, PartnerInnen, Eltern, andere Angehörige, Freunde, Kollegen, Suchtbetroffene, Fachleute, Journalisten und alle anderen, die sich informieren wollen. Die Inhalte bilden das Spektrum von trockenen Fachkonzepten bis hin zu kreativen Medien ab. Um Ihnen die Orientierung zu erleichtern, gibt es erstens ein Sidemap, welches Sie auf jeder Seite unten links im Footer aufrufen können. Zweitens finden Sie unten auf den Seiten die Rubrik Obendrein mit Vorschlägen für inhaltlich ähnliche, weiterführende Seiten.
» Sidemap
Eine Angehörigenproblematik
Verschiedene Gruppen sind als Angehörige von Sucht betroffen: Kinder, erwachsene Kinder, Partner, Eltern, Geschwister, Freunde, Arbeitskollegen, Suchthelfer etc. Die Betroffenheit hat zwar viele individuelle Gesichter, doch es gibt meines Erachtens nur eine Angehörigenproblematik. Das möchte ich Ihnen anhand von zwei Argumenten erläutern.
Erstens überschneiden sich die Betroffenengruppen erheblich. Dies liegt an der co-abhängigen Transmission (» mehr). Mädchen - seltener Jungen - aus Suchtfamilien, suchen sich als Erwachsene überdurchschnittlich häufig suchtkranke Partner. Aus diesen (co-)abhängigen Partnerschaften gehen wiederum süchtig und co-abhängig gefährdete Kinder hervor. Geschätzt die Hälfte der Partnerinnen und Mütter und auch, doch seltener Partner und Väter, die ich in über 20 Jahren Angehörigenarbeit behandelt habe, ist biografisch schon durch eine Kindheit in einer Suchtfamilie vorbelastet gewesen.
Zweitens sind alle Personen, die in einem engen, langfristigen Kontakt mit Suchtkranken stehen, denselben Belastungen ausgesetzt: Das berauschte und entzügige Verhalten der Suchtkranken ist selbstsüchtig, verantwortungslos und unzuverlässig. Als Reaktion darauf entwickeln die Angehörigen komplementäre Muster der Selbstlosigkeit, Verantwortungsübernahme und Verlässlichkeit, um die Defizite der Suchtkranken auszugleichen. Auch wenn Kinder zweifelsohne aufgrund ihrer ungefestigten Persönlichkeit besonders vulnerabel sind, sind die psychosozialen Leiden und Folgeprobleme der unterschiedlichen Angehörigengruppen im Prinzip dieselben.
Aus den beiden genannten Gründen wird die Angehörigenproblematik auf dieser Website ganzheitlich betrachtet und behandelt.
Suchthelfer sind Angehörige
Bevor ich mich ambulant als Psychotherapeut niedergelassen habe, habe ich lange als Suchttherapeut gearbeitet. Damals habe ich nach und nach begriffen, dass die Themen und Probleme der Angehörigen ähnlich den beruflichen Herausforderungen der Suchthilfe sind. Auch Suchthelfer können sich in selbst aufopfernden und Verantwortung schulternden Mustern verlieren. Wie Dachdecker vom Dach fallen können, können sich Suchthelfer verstricken. Es ist ihr Berufsrisiko.
Die therapeutische Arbeit mit Angehörigen ist Psychohygiene für Suchthelfer. Indem ich Angehörigen geholfen habe, klarer zu werden und sich besser abzugrenzen, habe ich implizit gelernt, mich gegenüber der suchtkranken Klientel konsequenter zu verhalten. Es hat mir geholfen, sowohl die Sorge für die süchtige Klientel als auch die Selbstfürsorge im Berufsalltag besser auszubalancieren, um nicht auszubrennen und hart und negativ zu werden. Zynismus ist eine häufig zu findende Form der psychischen Beschädigung von Suchthelfern und Angehörigen.
Der Begriff Angehörige wird auf dieser Website als eine Kategorie verwendet, unter die auch Suchthelfer fallen. Alle Inhalte richten sich gleichermaßen an familiär und beruflich Betroffene.
Angehörige von psychisch kranken Personen
Alle Angehörigen von psychisch kranken Personen sind belastet. Warum beschränkt sich diese Website auf das Angehörigenthema der Sucht?
Abhängigkeitserkankungen sind auch psychische Störungen, doch sie unterscheiden sich in einem Aspekt von den meisten anderen psychischen Störungen. Der Suchtmittelmissbrauch ist der Versuch, eine primäre psychische Erkrankung zu bewältigen. Durch den Rausch werden die psychischen Leiden betäubt. Kurzfristig sorgt dies zwar für Erleichterung, doch langfristig verschlimmert sich derart die primäre Problematik und schafft zudem zerstörerische Folgeprobleme. In der Problemverleugnung, den süchtigen Manipulationen, Beschämungen und Beschuldigungen und den rausch- und entzugsbedingten Übergriffigkeiten entwickeln Suchterkrankungen zerstörerische Auswirkungen auf das soziale Umfeld.
Diese schädigenden sozialen Effekte sind bei anderen psychischen Störungen in der Stärke und dem Ausmaß nur selten zu finden. Bitte missverstehen Sie mein Argument nicht, es beschreibt nur eine Tendenz. Ihre konkrete, individuelle Situation kann nämlich ganz anders aussehen, z.B. können Angehörige von Personen mit Impulskontrollstörungen ebenfalls Übergriffigkeiten erfahren. Übrigens gehen solche aggressiven Störungen häufig mit Suchtmittelmissbrauch einher. Nichtsdestotrotz ist - im Gegensatz zur süchtigen Uueinsichtigkeit - den meisten psychisch erkrankten Personen sehr wohl bewusst, dass sie krank sind, und sie tun alles, damit andere nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.
Diese Website muss inhaltlich begrenzt werden, damit sie nicht ausufert und beliebig wird. Diese Entscheidung hat Vorteile, sie hat aber auch Nachteile. Die Problematik von Angehörigen psychisch kranker Personen wird auf CO-ABHAENIGIG.de implizit berücksichtigt. Sind Sie als Angehörige in diesem Sinne betroffen, sind Sie eingeladen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkunden.
Illustrationen
Die Illustrationen von Prinzessin & Frosch, welche diese Website schmücken, sind von Sina Gruber, eine junge Künstlerin und damals Studentin der Psychologie aus Kassel. Die 23 Werke entstanden 2013 auf Grundlage des Manuskriptentwurfs zum Ratgeber "Ich will mein Leben zurück!"
Anliegen
Co-ABHAENGIG.de habe ich 2010 eingerichtet, als mein erstes Fachbuch zum Thema herauskam. Damals hat es im deutschsprachigen Raum kaum informative Internetrepräsentationen zum Thema gegeben. Seitdem sind zwei weitere Fachbücher entstanden, ich habe eine Reihe an Artikeln verfasst, unzählige Vorträge gehalten, Interviews gegeben und Workshops und Fortbildungen zum Thema durchgeführt. Darüber hatte ich viele bereichernde Begegnungen zu Betroffenen wie auch zu anderen, in der Sache engagierten Fachleuten. Es sind kleinere und größere, kurz- und langfristige Kooperationen zustande gekommen. Vor allem aber habe ich von meinen Klienten gelernt. Ihre Erfahrungen sind für mich Geschenke. Ich bin dankbar, dass ich an ihren Entwicklungen, sich zu befreien und ihr Leben zurückzuerobern, teilhaben darf.
So ist aus dem in der Freizeit gepflegten Steckenpferd mein heutiger Arbeitsschwerpunkt geworden. Mit diesem Prozess ist auch die Website peu à peu gewachsen. Motiviert durch die Kooperation mit der Kollegin und Mitautorin, Judith Barth, habe ich mit dem Jahreswechsel 2020/21 alle Inhalte gründlich überarbeitet, Design und Navigation erneuert und jede Menge neue Seiten hinzugefügt. Das Motiv für mein Engagement hat sich in all den Jahren nicht verändert: Ich möchte über eine tabuisierte Thematik aufklären und zum kritischen Nachsinnen und konkreten Handeln anregen. Darüber hinaus gestalte ich die Website eigenständig und unabhängig und verfolge damit keine wirtschaftlichen, institutionellen oder sonstigen Interessen.