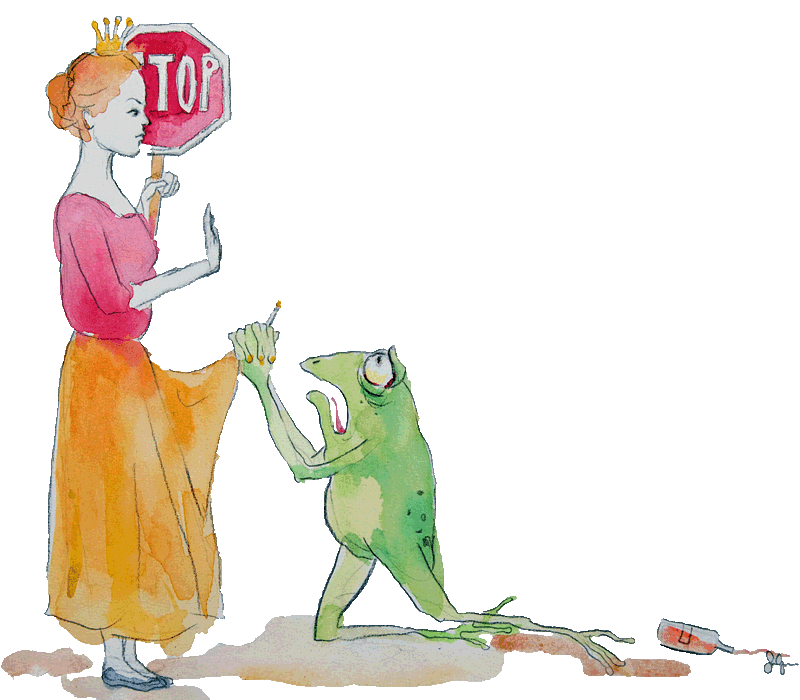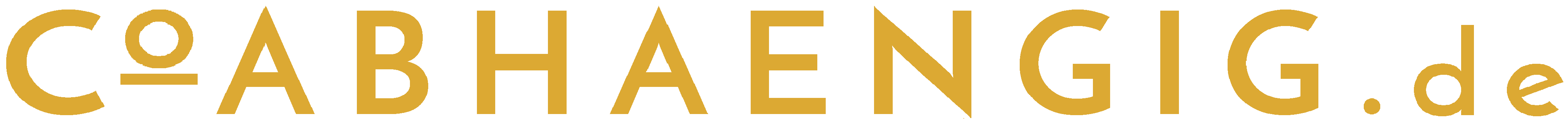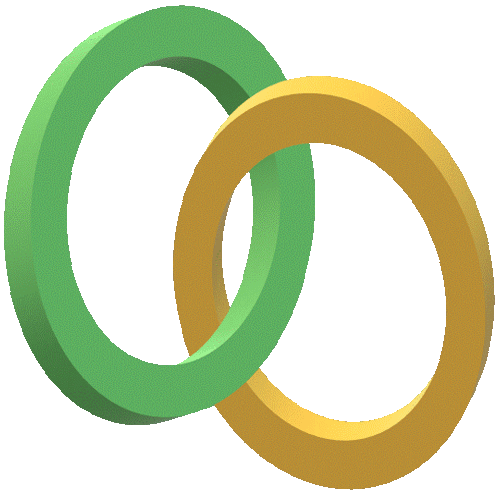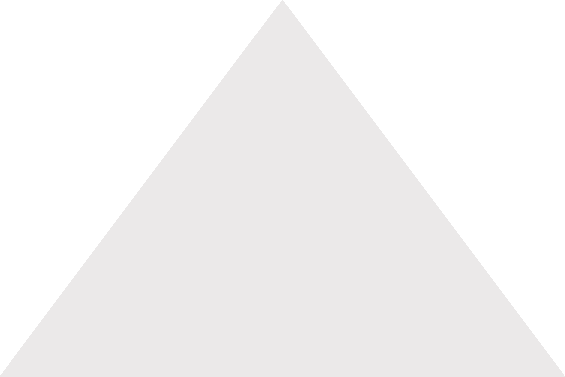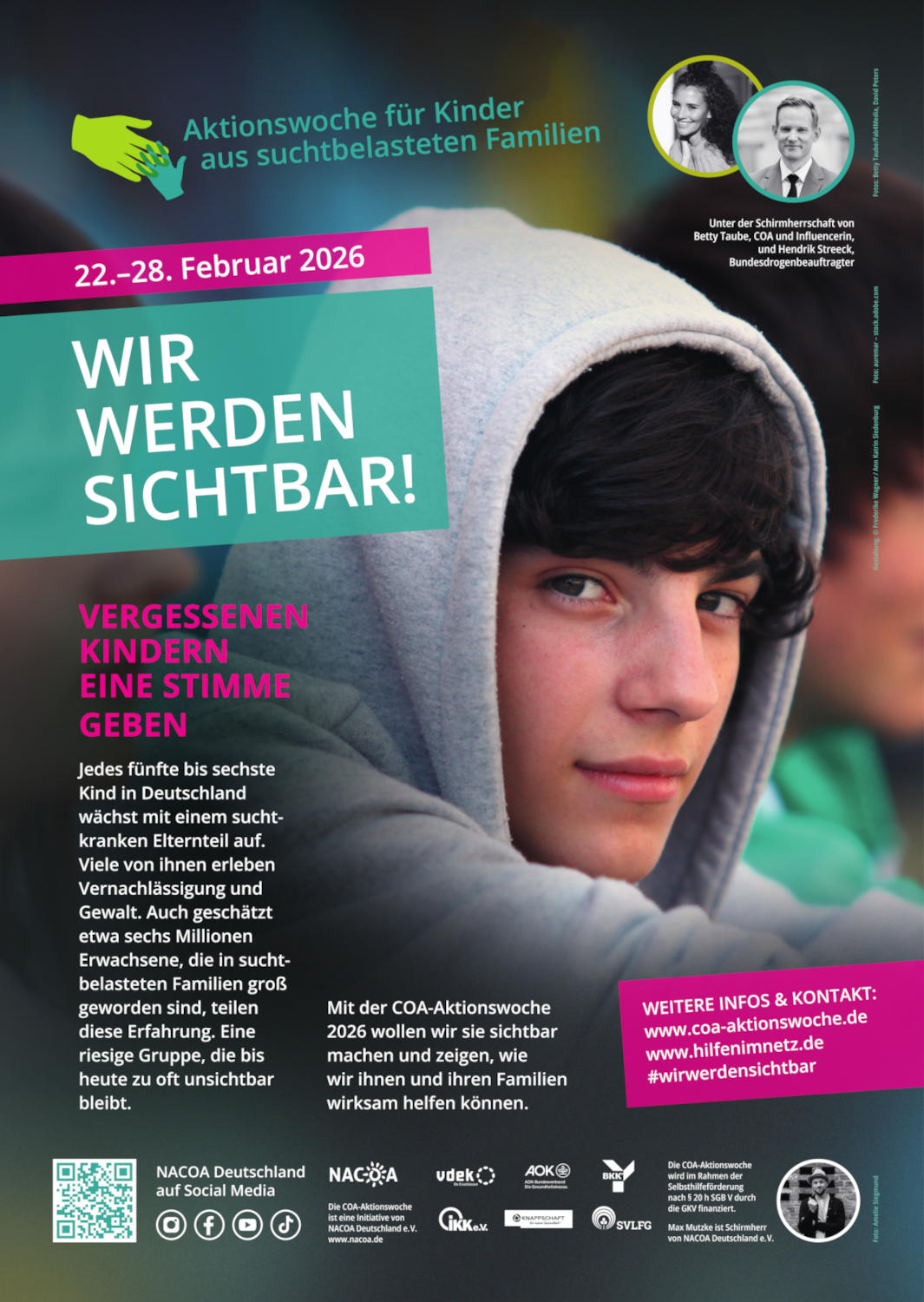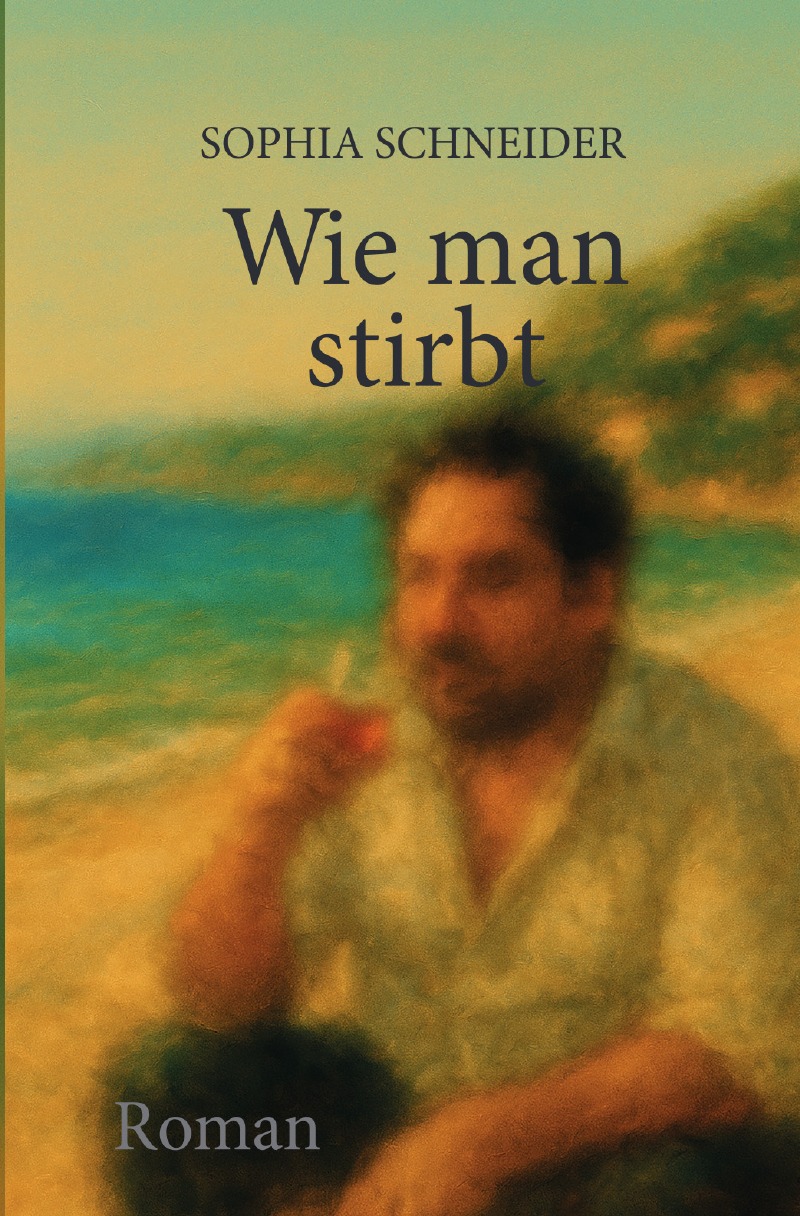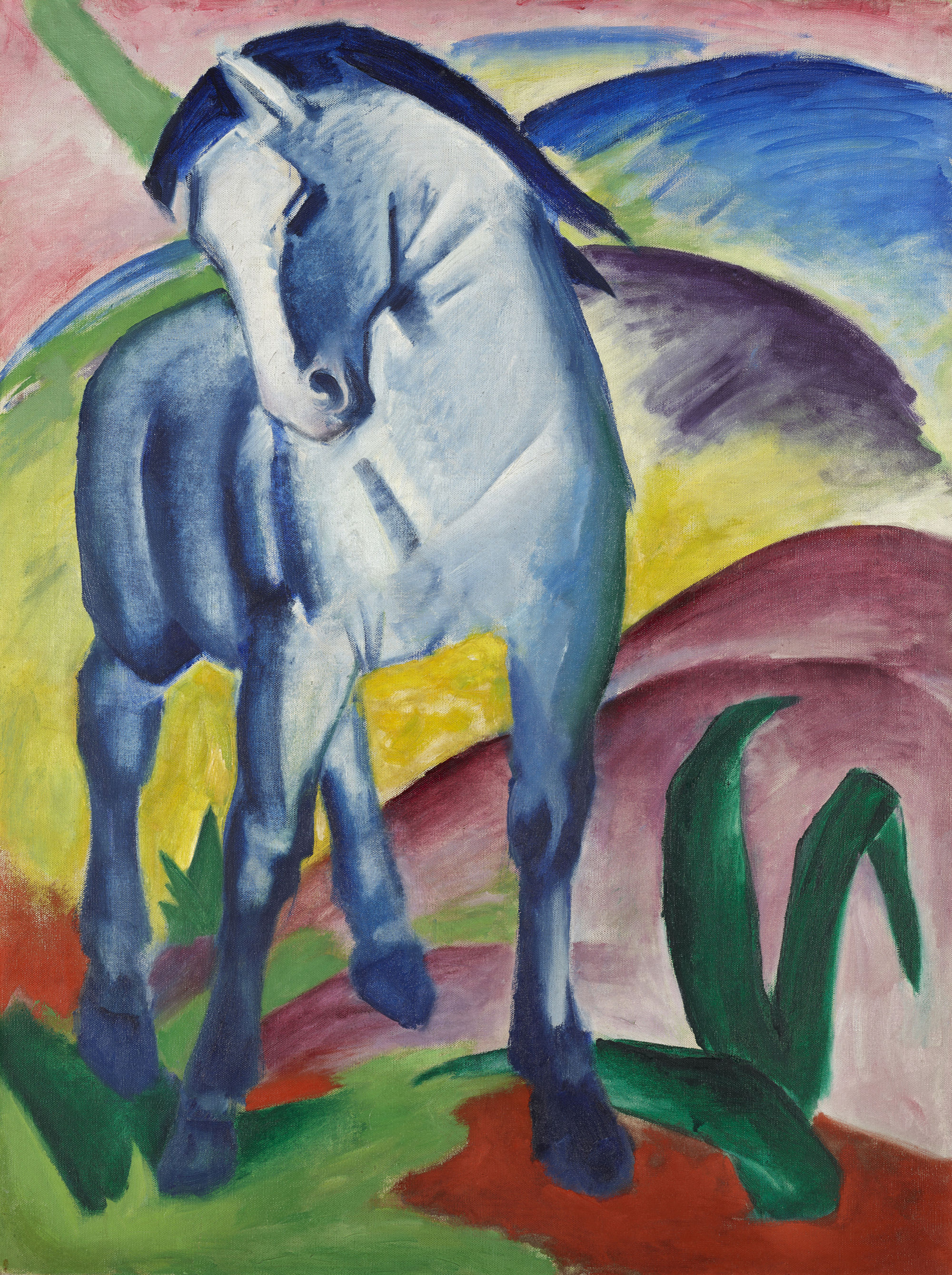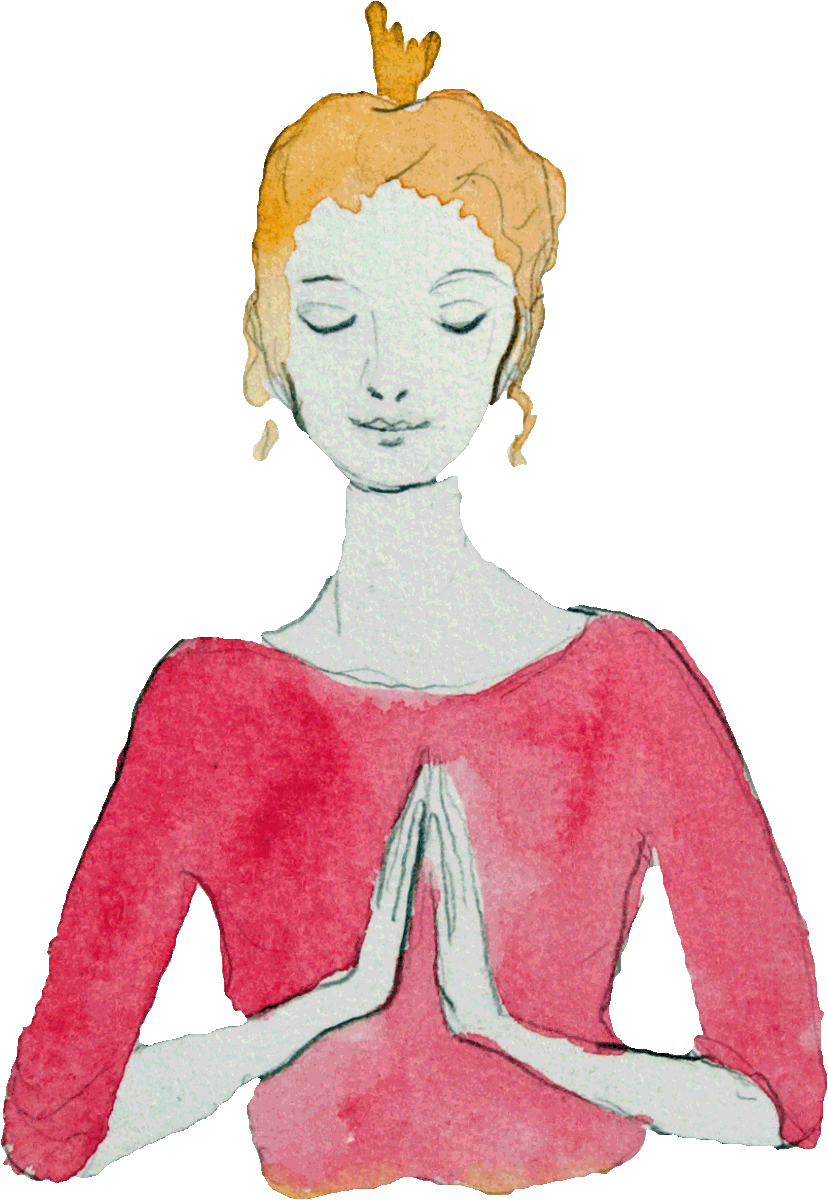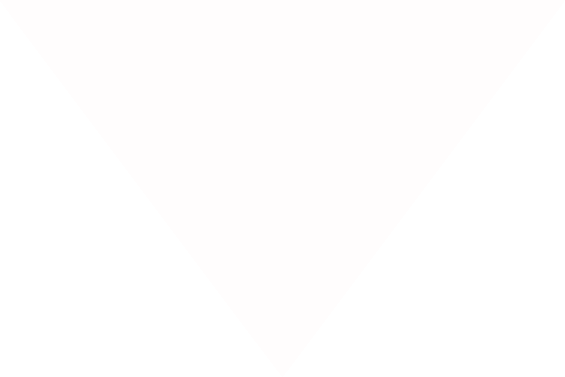Schneider, S. (2025). Wie man stirbt. Berlin: epubli.
Die Tage war ich mit einem Freund abends im Park laufen. Ein Besoffener pöbelte zwei andere Männer an. Er schrie hasserfüllt Unflätiges und fluchte rassistisch. Wir haben versucht, zu deeskalieren, und sind als Folge ebenso von ihm beschimpft worden. Es war widerlich und ich habe mich hilflos gefühlt. Ekel und Ohnmacht sind auch die beherrschenden emotionalen Themen in dem autobiografischen Roman von Sophia Schneider. Sie beschreibt, wie sie ihren Vater als junge Frau bis in den alkoholbedingt vorzeitigen Tod begleitet. Der Ekel bleibt nicht abstrakt: offenen Beine, verfaulendes Fleisch, Inkontinenz, Blut, Erbrochenes, Gestank, Hass, Selbstgerechtigkeit, berauschte Eskapaden, Selbstsucht. Schneider ist schonungslos und zeigt die widerliche Seite der Sucht, die sich in dieser siechenden Form in keiner anderen Autobiografie findet.
Das Abstrakt von der Verlagsseite:
In einem spanischen Ferienort kümmert sich Sophia um ihren Vater, der sich durch Alkohol, Delirium und Selbstzerstörung in den Tod trinkt – und konfrontiert dabei die Abgründe ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Während sie den körperlichen Verfall, die emotionale Grausamkeit und schließlich den Tod begleitet, zeigt ein inneres Märchen von Tao, einem jungen Puma, ihre psychische Realität in poetischen Bildern. Am Ende gewinnt sie nicht das Vergessen, sondern etwas Stärkeres: die Fähigkeit, der Vergangenheit in die Augen zu sehen, ohne in ihr zu verschwinden.
Das Buch erzählt nicht nur von dem dahinsiechenden Korsakow des Vaters, es gibt den emotionalen Reaktionen der Protagonistin, ihren Gegenübertragungen viel Raum. Sie schildert ihre Ambivalenz zwischen liebevollen Wünschen, den Vater nicht auf seinem letzten Lebensweg allein lassen zu wollen, und den angeekelten Bedürfnissen, das Weite zu suchen bzw. sich manchmal zu wünschen, dass er endlich stirbt und es vorbei ist. Durch kleine Aktivitäten, z.B. im Meer zu schwimmen, das Voranbringen der Promotion und Kontakte zu anderen, verschafft sie sich immer wieder Luft und schafft es, den Kontakt zu sich selbst zu erneuern.
Sie beginnt, eine Fabel über den Pumajungen Tao - eine Anspielung auf den Daoismus - zu schreiben, der die Welt retten muss, weil die Farben verschwinden. Diese Allegorie ist geschickt gesetzt, denn im helfenden Kontakt zu suchtkranken Menschen geht es darum, die eigene Farbigkeit zu bewahren. Als Leser habe ich mich über die kleinen Pausen, die durch die kursiv gesetzten Fortsetzungen der Fabel entstanden, gefreut. Sie haben mir geholfen, die Abscheulichkeiten auszuhalten, die aus dem Buch sprichwörtlich quillen und spritzen.
Weil niemand ein Buch besser einordnen kann als die Autorin selbst, lassen wir das Buch ein wenig sprechen (S. 46, 89 - 91, 110 - 111, 151):
Mich bedrückte schon länger die Frage, ob ich zwischen dem Gefühl, von der Zuneigung und Zustimmung anderer abhängig zu sein, und Dankbarkeit und Erleichterung, wenn ich beides bekam, und dem, was man 'Liebe' nannte überhaupt unterscheiden konnte. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, als seien Co-Abhängigkeit und Liebe, von dem Moment an, an dem ich auf die Welt kam, eins gewesen.
Am liebsten hätte ich ihn auf Abstand gehalten. Auch andere. Warum? Um nicht verletzt zu werden, klar. Aber auch, damit niemand sah, wie es in mir war. Meine Wunden, meine Schäden, meine Scham. Zu viel Nähe mochte ich nicht. [...] Mein Instinkt sagte nur eins: Schütz dich. Schütze dich, egal womit. Wenn die Mauer fiel - was stand dann noch zwischen mit und der Welt? Zwischen mir und ihm? Und das Absurde: Es brachte nichts, mich zu verstecken, zu schützen; denn was ich bekämpfte, war bereits in mir. [...] Ich wollte mich einfach ins Bett legen. Mein Rücken tat weh. Mein Herz tat weh. Alles tat weh. [...] Ich blieb sitzen. Denn wovor ich wirklich Angst hatte, war nicht sein Urteil. Es war meins.
So anstrengend es war, mich dieser ganzen Situation ausgeliefert zu fühlen - wirklich ausgeliefert war ich nicht. Ich war erwachsen. Ich konnte wegfahren, Türen hinter mir schließen, Pausen machen. Wie musste es erst Kindern gehen, die einem Alkoholiker wirklich ausgeliefert waren? Meine eigene Kindheit würde ich nicht einmal richtig dazuzählen. Nach außen war alles behütet, ordentlich, funktionierend. Die Fassade stand. [...] War eine heile Fassade ein Schutz - oder nur ein anderes Gefängnis? Um überhaupt so tun zu können, als sei alles normal, brauchte es ja mindestens einen Rahmen. Einen, der nicht völlig zerfallen war. Ich hatte diesen Rahmen. Viele hatten ihn nicht. Wie viele Kinder und Jugendliche lebten in Verhältnissen, in denen nicht einmal der Schein hielt? Dauerhaft. Unsichtbar. Wer half ihnen? Wer sah sie, wenn ihre Eltern mit ihrer Sucht gerade noch so unter dem Radar der Behörden durchglitten?
Wenn wir in unserem ängstlichen Leben noch schön konsumeren konnten, fühlten wir uns frei. Denn was war das, was wir für Freiheit hielten, ja, was wir mit Freiheit verwechselten: Konsumfähigkeit. Es war so absurd: Die einzige "Individualität", die unsere Gesellschaft duldete, war die, die man kaufen konnte. Und wer sich über den Konsum definierte, war am Ende wie alle - nur mit dem Gefühl, besonders zu sein. Armselig, wie gut das funktionierte.
Schneider nutzt den Begriff der Co-Abhängigkeit, um das Erleben und Handeln der Protagonistin intelligent zu hinterfragen. Die Ich-Erzählerin stellt Fragen und reflektiert. Sie probiert Antworten aus, ohne abschließende Antworten zu geben, was wohltuend ist. Als Fachbuchautor, der ein Konzept zur Co-Abhängigkeit erstellt hat, möchte ich der Protagonistin wie auch der Autorin indes eine Antwort geben: Meines Erachtens verhält sie sich im Großen und Ganzen nicht co-abhängig. Ihr Wunsch, den Vater in den Tod zu begleiten, ist nicht co-abhängig zu werten. Sie wird zwar oft durch ihre widerstreitenden Gefühle geflutet, doch sie wehrt sie nicht ab; sie verleugnet sich - abgesehen von Momenten der Überforderung - nicht wirklich selbst. Sie verhält sich riskant, aber sie achtet auf sich, sich nicht in der Hilfe zu verlieren, und ergreift immer wieder notwendige Maßnahmen der Selbstfürsorge.
Dieser Entwicklungsprozess ist beeindruckend, ein wenig sogar vorbildhaft. Wie man stirbt ist ein Beispiel dafür, wie man einem suchtkranken Menschen auf dem letzten Weg helfen kann, ohne die eigene Würde beschädigen zu lassen, auch wenn sich die Person würdelos und verletzend verhält. Es ist ebenfalls ein Beispiel dafür, wie viel Kraft dies erfordert; aus dem Epilog (S. 270): "Die wahre Kunst beim Schreiben dieses Buches bestand darin, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren." Davor verneige ich mich.
» Das Buch bei epubli