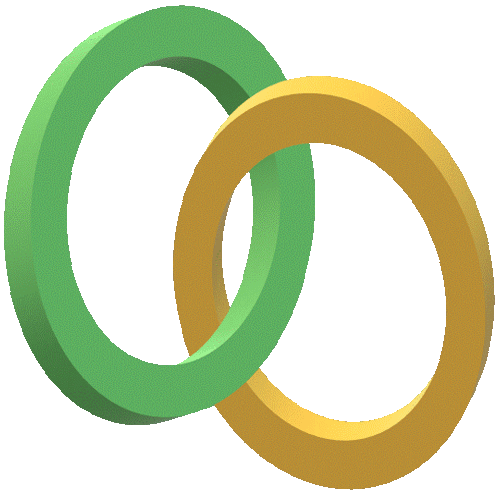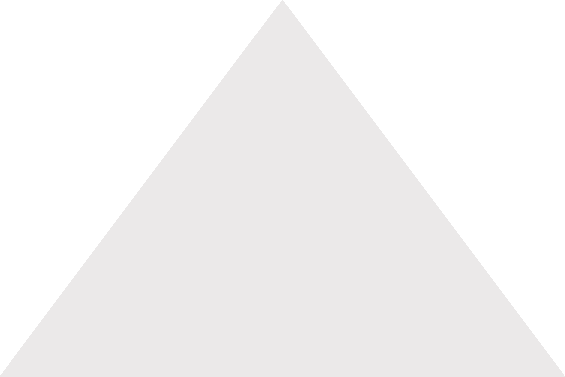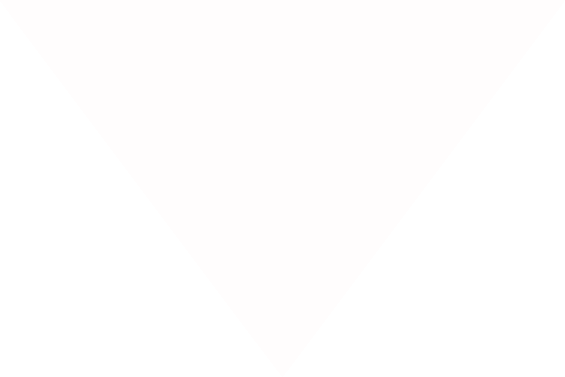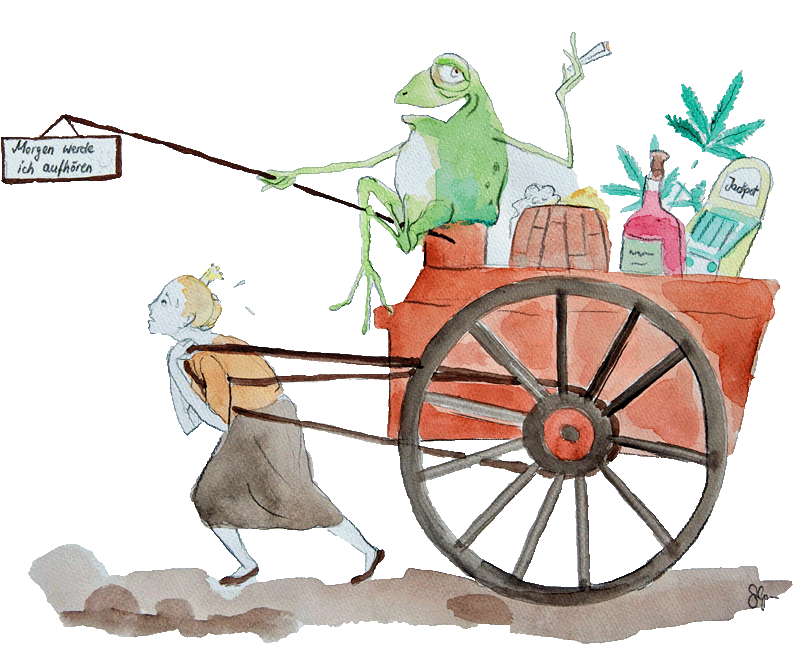
Betroffenheit
Angehörige sind nicht nur mit-betroffen, sie sind betroffen. Das Zusammenleben mit einem Suchtkranken ist belastend, manchmal auch traumatisch. Die Betroffenheit der Angehörigen und ihre Belastungen, ihre Probleme und ihr Leiden werden hier unter dem Begriff der Co-Abhängigkeit zusammengefasst. Es wird als ein vielschichtiges individuelles, soziales, institutionelles und gesellschaftliches Phänomen verstanden.
Sucht und Co-Abhängigkeit können als zwei Seiten ein und derselben Medaille der Abhängigkeit angesehen werden. Es sind die zwei definierenden Elemente des abhängigen sozialen Systems. Da, wo jemand süchtig ist, gibt es immer Angehörige, Kinder, Freunde, Kollegen oder andere, die unter den Auswirkungen der Sucht leiden und sich in den Bemühungen um den Suchtkranken verstricken. Sucht ist die Voraussetzung für Co-Abhängigkeit und Verstrickung begünstigt Sucht. Beiden Phänomenen liegt dieselbe abhängige Dynamik zugrunde und in der Wechselwirkung entsteht zwischenmenschliche Abhängigkeit.
Die Betroffenheit der Angehörigen hat viele Gesichter. Verschiedene nahestehende Personen, die einem Süchtigen nahe stehen und helfen wollen, können betroffen sein: Eltern, Partner, Kinder, Geschwister, Freunde, Arbeitskollegen oder professionelle Helfer. Genauso wie ein Suchtmittelproblem eine Person mehr oder weniger beherrschen kann, können Angehörige sich mehr oder weniger in ihrem Engagement für einen Suchtkranken verlieren. Folgende fünf Formen der Betroffenheit von Angehörigen unterscheide ich in meinem Konzept:
1. Typische Erlebens- und Verhaltensweisen mit Risiko
2. Stress und Verstrickungen
3. Co-abhängige Störung inklusive depressiver, ängstlicher und psychosomatischer Beschwerden
4. Komplexes Suchttrauma (erwachsener) Kinder aus Suchtfamilien
5. Soziale, institutionelle und gesellschaftliche Co-Abhängigkeit
Hinweis: Diese Seite basiert vornehmlich auf der Konzeption der Angehörigenproblematik aus dem Fachbuch "Co-Abhängigkeit".