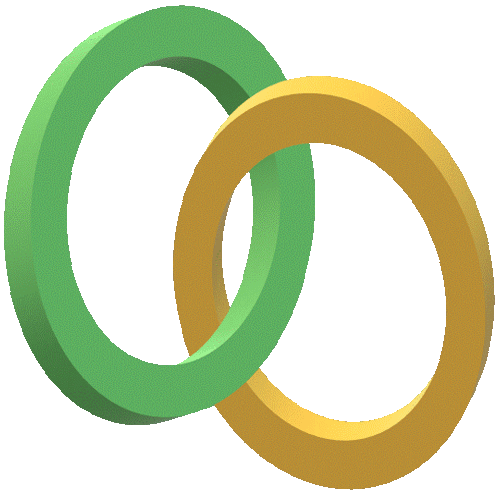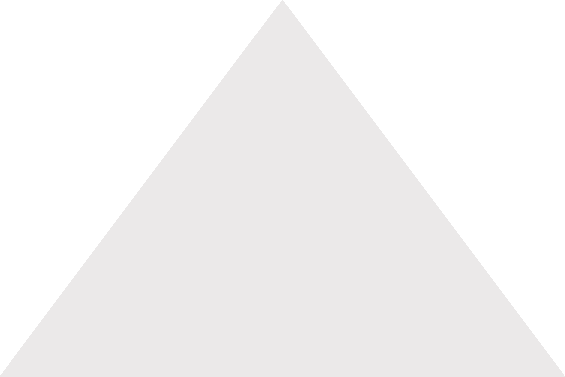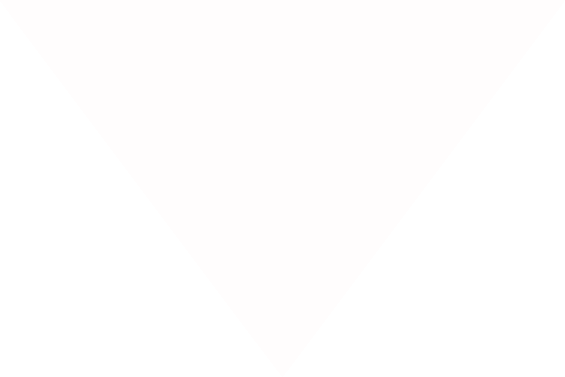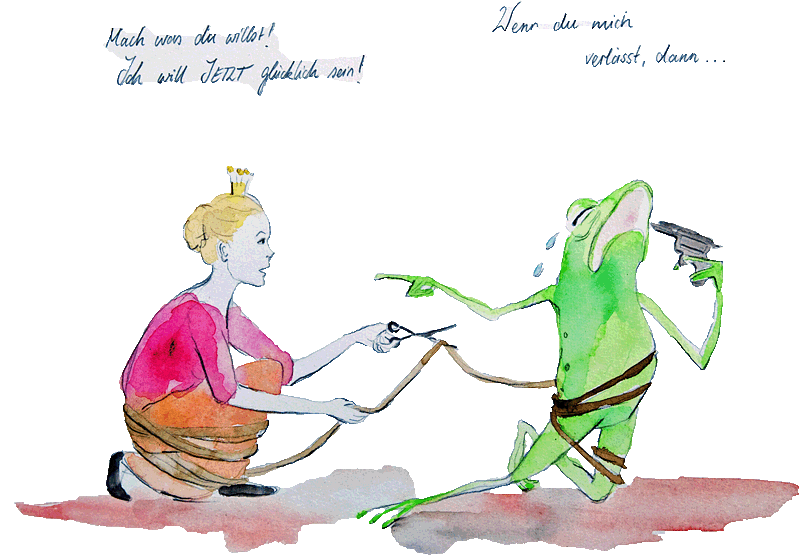
Kurzgefasst
Immer wieder - in den letzten Jahren gehäuft - werde ich von JournalistInnen kontaktiert, die Beiträge zum Angehörigenthema bringen wollen und bei ihrer Recherche auf CO-ABHAENGIG.de stoßen. Die Anfragen lösen ambivalente Reaktionen in mir aus. Auf der einen Seite sind Interviews stressig und ich bin nicht gut darin, verstrickte Sachverhalte eloquent auf den Punkt zu bringen. Als Psychotherapeut kann ich besser Fragen stellen, als Antworten geben, oder therapeutische Impulse geben, damit jemand sich auf die Suche nach Antworten macht. Die JournalistInnen wünschen - verständlicherweise - prägnante Antworten und unterschätzen dabei die Komplexität der co-abhängigen Problematik und die gesellschaftliche Brisanz des Tabuthemas.
Auch fallen Interviews nicht in meinen Aufgabenbereich. Ich bin Psychotherapeut, was mich beruflich ausfüllt. Für Information und Aufklärung zum Thema sind eigentlich der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, die Landesstellen für Sucht, die Suchtpräventionsstellen und die Suchtverbände zuständig. Mir stellt sich die Frage: Wieso muss ich als "kleiner Therapeut" in die Bresche springen, nur weil diese Stellen, die dafür vorgesehen und bezahlt werden, ihren Job nicht ordentlich machen?
Auf der anderen Seite benötigt die co-abhängige Angelegenheit Öffentlichkeit. Ich möchte, dass sie angemessen in den Fokus der gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Aufmerksamkeit gerückt wird. Genau daran mangelt es. Ich begrüße das Engagement der JournalistInnen und möchte es gerne unterstützen. Angeregt durch die neugierigen Fragen der MedienvertreterInnen ist diese Seite entstanden. Für den schnellen Überblick habe ich Interviewfragen gesammelt und versucht, sie kurz und bündig zu beantworten.