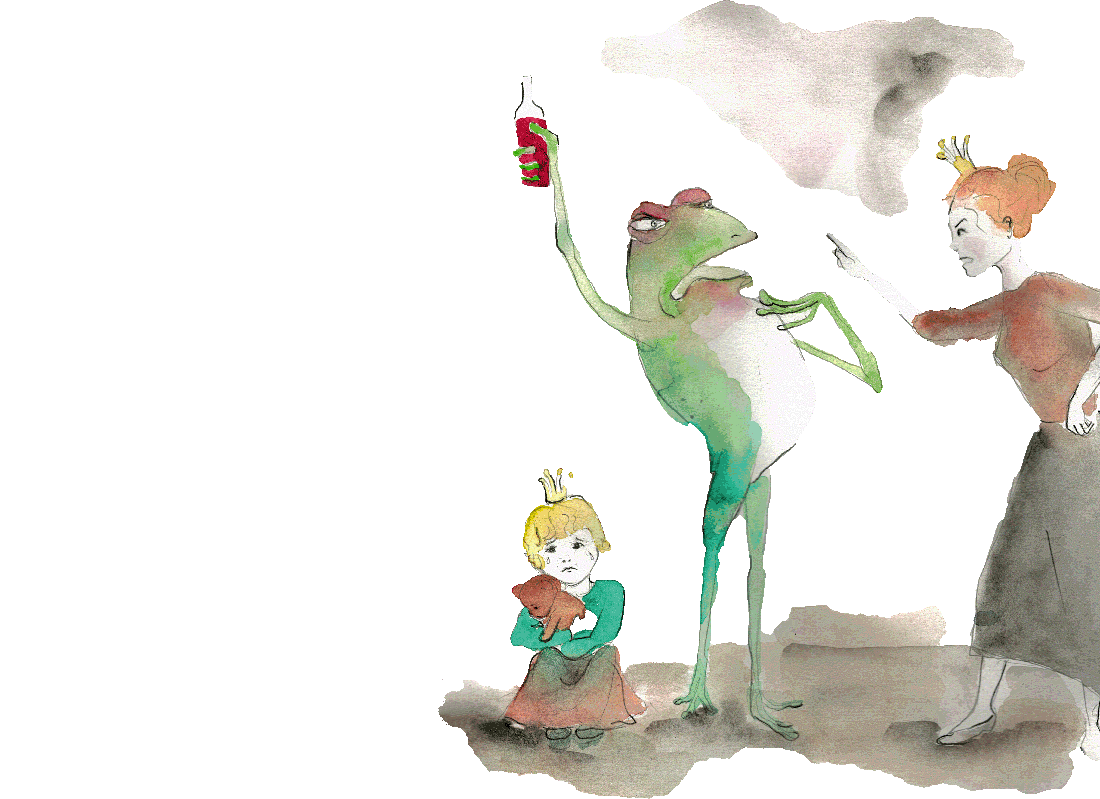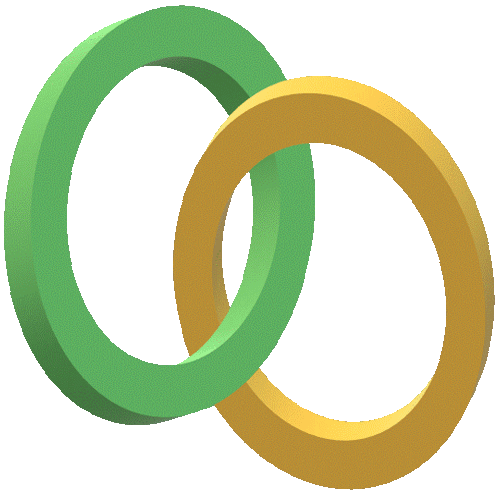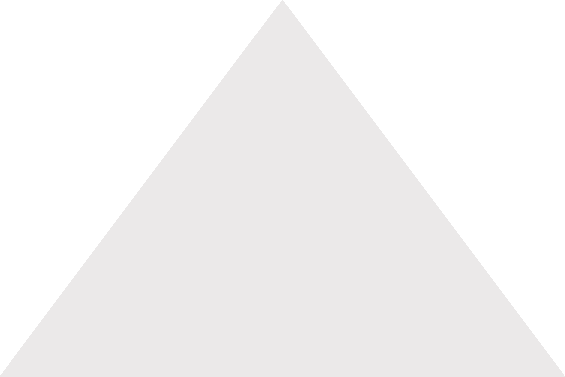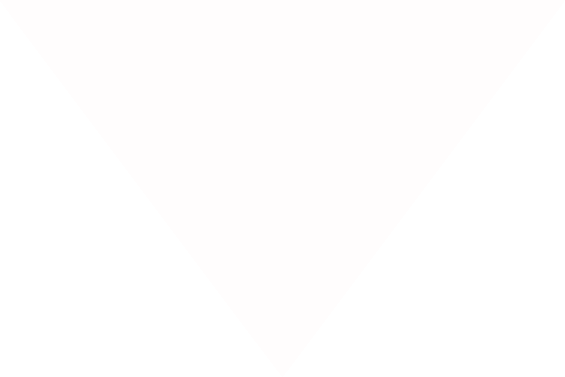Lassen Sie uns ein letztes Mal den Blickwinkel wechseln: Anamnese, Diagnostik und Analyse sind in der Prävention, Beratung und Therapie nur Mittel zum Zweck. Eine gründliche Analyse dient dazu, eine bedarfsgerechte Hilfeleistung zu ermöglichen. Es ist unser eigentliches Anliegen. Vier zentrale Implikationen für die Behandlung möchte ich aus meiner bindungstheoretischen Problemanalyse ableiten.
Erstens: Kinder aus Suchtfamilien mit Bindungsstörungen benötigen Hilfemaßnahmen, die sich durch zeitliche und personelle Beständigkeit auszeichnen. In der Prävention sind Gruppenprogramme wie Trampolin oder auch Naturprojekte weit verbreitet. Diese bieten z.B. zehn Sitzungen über einen Zeitraum von einem halben Jahr an. Die Programme sind inhaltlich gut gemacht, doch der zeitliche Rahmen ist schlichtweg ungenügend: Es ist ein Wassertropfen auf einen heißen Stein. Positive Beispiele von Beständigkeit sind Patenschaften, SozialarbeiterInnen an Schulen, zu denen Betroffene jahrelang gehen können, um sich zu entlasten und Unterstützung zu erhalten. Oder auch Beratungen, Selbsthilfegruppen oder Psychotherapien, die einem langfristigen Prozess Raum geben.
Indem wir als Pädagogen, Berater oder Therapeuten das Im-Kreis-Drehen der Klienten immer wieder mitmachen, sie darin nicht alleinlassen, werden die dysfunktionalen Bindungsmuster bzw. Schemata nach und nach abgemildert. Steter Tropfen höhlt den Stein. Dies benötigt liebevolle und tolerante Beharrlichkeit.
Zweitens: Hilfen für betroffene Kinder sollten beziehungs- bzw. bindungsbezogen sein. Die Behandlung des Suchttraumas spielt sich vor allem auf der Beziehungsebene ab. Das ständige Bemühen des Therapeuten und auch das im Verlauf der Therapie wachsende Bemühen des Klienten um eine sichere, vertrauensvolle, offene und unabhängige Beziehung ist der Kernprozess der Therapie. Der Beziehungsgestaltung wird alles andere untergeordnet und nur dort, wo ein sicherer Bezug herrscht, können andere Methoden, Interventionen oder Techniken erfolgreich zum Einsatz gelangen. Deswegen sind bei einem gravierenden Posttrauma auch Einzelmaßnahmen zunächst Methode der Wahl. Nur sie bieten einen Schutzraum, in dem Selbst- und Sozialvertrauen nachreifen kann. Erst wenn dies ausreichend vorhanden ist, können Gruppenmaßnahmen eingesetzt werden.
Drittens: Hilfen sollten systemisch organisiert oder vernetzt sein. Das Kind - gleichgültig, ob es noch Kind oder schon erwachsen ist - ist Teil eines abhängigen Systems. Bei einem Kind, das noch Kind ist, haben wir als Pädagoge, Präventionskraft oder Therapeut keine Chance, wenn nicht mindestens eine Bindungsperson mitzieht und ebenfalls eine Entwicklung durchmacht. Ansonsten verpuffen die Therapieeffekte im belasteten und traumatischen Lebensalltag der Kinder und können sogar schädigende Wirkung haben. Wenn ein Kind beispielsweise in der Therapie lernt, offen zu reden, dann wird es infolgedessen Familiengeheimnisse verletzen. Tabubruch in Suchtfamilien wird bestraft. Wenn die Familie nicht ebenfalls lernt, die Problematik zu benennen und zu besprechen, muss die Intervention nach hinten losgehen.
Kindbezogene Maßnahmen sollten deswegen flankiert von weiteren Maßnahmen werden, die an anderen Stellen des Bezugssystems ansetzen. Im Idealfall sollte gleichzeitig auf das Kind, die co-abhängige Bezugsperson und die süchtige Bezugsperson durch Hilfemaßnahmen eingewirkt werden. Bei erwachsenen Kindern können wir hingegen in familiär aussichtslosen Fällen darauf hinwirken, dass die Betroffenen sich von ihrer Familie distanzieren und sich eine neue Familie schaffen. Eine Klientin drückte es mal wie folgt aus: „Meine Freunde sind meine Ersatzfamilie.“
Viertens: Hilfemaßnahmen für Kinder aus Suchtfamilien wie auch für andere Angehörige sollten solidarisch sein. Angehörigenzentrierte Solidarität ist dadurch gekennzeichnet, dass die Themen der Betroffenen in der Behandlung im Vordergrund stehen. Darüber hinaus beinhaltet es einen zweiten wichtigen Aspekt. Kinder aus Suchtfamilien sind Opfer von Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt. Sie entwickeln häufig Traumafolgestörungen, wie z.B. klassische oder komplexe PTBS. Solidarität in der Traumabewältigung ist parteiisch.
Solidarität mit Kindern bzw. Opfern klingt so selbstverständlich, ist es aber in der Praxis nicht. Es gibt einen Mangel an Angeboten für Kinder aus Suchtfamilien und für andere Angehörige. Dies ist seit ca. 40 Jahren bekannt. Und falls Angebote für Angehörige vorgehalten werden, stehen dabei gewöhnlich die Belange der Suchtkranken im Vordergrund. So werden Angehörige häufig co-therapeutisch genutzt, um auf die süchtigen Protagonisten Einfluss zu nehmen. In Bezug auf Selbsthilfe und Suchthilfe spreche ich deshalb von Systemversagen. Auch die Psychotherapie ist in Bezug auf die Kinder aus Suchtfamilie defizitär aufgestellt. Das Thema Abhängigkeit kommt in Studium und Therapieausbildung kaum vor. Allein die Jugendhilfe möchte ich positiv hervorheben. Sie ist das einzige System, welches nach meiner Erfahrung die Problematik der Kinder aus Suchtfamilien solidarisch im Blick hat.
Dort, wo Systeme versagen, sind Projekte, die es besser machen, umso wichtiger. Die Angehörigenberatung des Diakonischen Werkes in Herford und Fitkids sind in meinen Augen Leuchtturmprojekte, die eine Menge Solidarität ausstrahlen und auch die drei anderen genannten Qualitäten realisieren. Es ist wichtig, dass sich die wenigen vorbildhaften Projekte, die es gibt, vernetzen, um gemeinsam noch mehr Strahlkraft zu entwickeln.